Vierter Erfahrungsbericht 2017
Lieber Leser,
in diesem Eintrag werde ich mich „der Relevanz von Profanem“ widmen. – Klingt hochgestochen, aber langweilig, oder?
Für einen „normalen“ Deutschen ist das sicherlich auch so. Er hat eine Wohnung, täglich Essen, eine gute medizinische Versorgung und außerdem ein sowieso durch Verbraucherschutz, Hygieneamt … geschütztes Umfeld, beherrscht die deutsche Sprache, kann sich ausdrücken, wie er will, ist durch eine Vielzahl an verschiedensten privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln flexibel, wird in seinem (Arbeits-)Alltag durch Maschinen unterstützt, um nur die grundlegensten Gewohnheiten und Bedürfnisse anzusprechen.
In unserem Tal haben auch die allmeisten Menschen irgendwie ein Dach über dem Kopf und Essen gibt es reichlich und für fast alle Menschen erschwinglich, aber bei der medizinischen Versorgung sieht es schon anders aus. Gute medizinische Versorgung ist teuer und für viele nur schwer bezahlbar. Möchte man einen Termin in dem billigen und staatlichen Krankenhaus, der „Minza“, muss man schon morgens so früh wie möglich vor sechs Uhr einen „Cupo“ abholen, durch den man einen Termin bekommt. Und Krankheitsherde für Infektionen durch Viren oder Bakterien, aber auch die wohlbekannten Parasiten sind genügend vorhanden. Ein Stück Fleisch hängt auch mal eine ungewisse Zeit an Stunden oder Tagen auf dem „Mercado“ herum, ungekühlt, von Fliegen umschwärmt. Eine Kontrolle der Nahrungsmittel scheint es sowieso nicht zu geben. Leitungswasser ist parasitenverseucht und will man sich wie in Deutschland einfach einen Becher guten Leitungswassers abfüllen, muss man den erstmal abkochen oder filtern. Gerade für ausländische Mägen, wie die der Freiwilligen, kann der Aufenthalt in Urubamba so zu einer Herausforderung werden.
Bezüglich der Sprache ist es hier so, dass nicht nur wir deutschen Freiwilligen nicht alles verstehen. Manchmal kommt es vor, dass gerade die älteren Menschen vom Land kein Spanisch können, sondern nur Quechua.
Auch mit der Flexibilität ist es hier schwerer. Die allermeisten Menschen hier haben kein Auto. Das „colectivo“, ein Kleinbus, ist das Verkehrsmittel für Mittelstrecken, aber viele Wege müssen auch zu Fuß gegangen werden. Dabei kann es auch gut sein, dass dabei ein Sack mit zu verkaufender Ware auf den Rücken gebunden ist. Insgesamt werden viel weniger Arbeiten von Maschinen erledigt. Gerade die Feldarbeit ist kaum industrialisiert, es ist Gang und Gebe, Ochsen einzusetzen, mit der Hacke zu arbeiten und mit der Hand zu säen und zu ernten.
Wir Freiwilligen habe es in einigen Belangen noch etwas besser als die hiesige Bevölkerung: Wir leben in schönen, ziemlich regendichten Häusern, haben ein weit ausreichendes Taschengeld. Mit unserer Krankenversicherung, können wir uns jedes Krankenhaus leisten, dafür sind wir Freiwillige aber auch viel anfälliger für Krankheiten, weil unser Immunsystem nicht auf peruanische Herausforderungen ausgelegt ist. Viel öfter als in Deutschland muss man krank zuhause bleiben, kann nicht arbeiten, das peruanische Leben zieht wertvolle Tage lang an einem vorbei. Trotzdem ist es so, dass wir hier ja ganz normal leben wollen und z.B. nicht die ganze Zeit auf eventuell unsicheres Essen verzichten wollen, denn Essen ist immer ein wichtiger Teil der Kultur.
Unser Nachteil, wenn wir weiter in die Kultur einsteigen wollen, ist natürlich die Sprache: Wir sprechen kein Quechua und unser Spanisch ist auch nicht fließendes Peruanisch, wodurch man, von unserer Erscheinung mal ganz abgesehen, immer als Fremder, als Gringo identifiziert wird, weshalb einem oft eine andere Einstellung entgegengebracht wird.
Auf der einen Seite lernen wir deutschen Freiwilligen durch die hiesige Relevanz von Profanem sehr zu schätzen, wie wenig Gedanken wir uns in Deutschland über manche Dinge machen müssen. Auf der anderen Seite ist es hier nervig, durch manche den körperlichen Ansprüchen widrige Gegebenheiten (Krankheit, Höhe, Erschöpfung) negativ (zu Inaktivität, Trägheit, Ineffizienz…) beeinträchtigt zu werden.
Die logische Konsequenz einer Mitfreiwilligen war folgende Aussage: „Ich werde nicht mehr krank.“
Und ich glaube tatsächlich, dass der Wille ein entscheidender Faktor gegen Anfälligkeit für Krankheiten, Erschöpfung und Angst, sich machen (vor allem Essens-)Situationen zu stellen, ist.
Viele Grüße nach Deutschland!
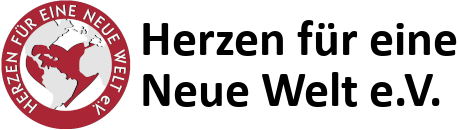
Artikel teilen: